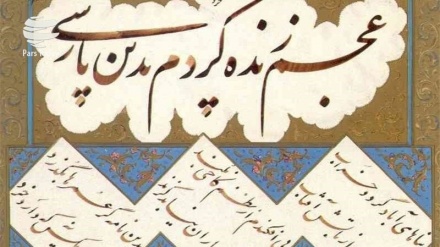Iranisches Kunsthandwerk (37 - Färbverfahren)
Wir besprechen weiter die Färbung des Materials für handgeknüpfte Teppiche. Zu den natürlichen Färbmitteln zählen Bestandteile von Pflanzen und von Tieren.
Die alten Phönizier entdeckten vor rund 4000 Jahren, dass sich aus dem Sekret bestimmter Stachelschnecken vor allem aus der eigentlichen Purpurschnecke eine prächtige rötlich-violette Tuchfarbe auskochen ließ, die überdies fast unbegrenzt haltbar war. Sie gewannen außerdem aus Galläpfeln, die auch mit Hilfe von Insekten entstanden, die Farbe Schwarz.
Die Menge an Farbstoff ist bei einigen Pflanzen wie Safran, Eiche oder Färberkrapp groß und bei anderen wie Plantane und Traubenblätter geringer. Die besten natürlichen Farbstoffe kommen aus den warmen Gebieten.
Natürliche Farben lassen sich einteilen nach pflanzlichen wie Indigo und Färberkrapp, tierischen wie das Insekt das sich auf Persisch Qermesdaneh nennt und bei dem es sich um die Schildlaus Cochenille handelt, und den Färbmitteln mineralischer Natur.
Die pflanzlichen Substanzen bilden die größte Gruppe von Färbmitteln, die verwendet werden. Dabei findet bei einigen Pflanzen ein ganz bestimmter Bestandteil Anwendung, wie zum Beispiel beim Judasbaum,(Gol-e arghawan) die Blüte. Zu den Pflanzen, deren Blätter für die Färbung dienen, gehören die Traube und die Plantane. Andere pflanzliche Farben werden aus den Stengeln und Zweigen gewonnen wie bei der die Aloe Vera (Sabr Zard) und der Kastanie. Bei manchen Pflanzen liefert die Rinde Färbstoff. Das ist zum Beispiel beim Brombeerstrauch der Fall. Es gibt auch Pflanzen, deren Frucht bei der Färbung dienlich ist wie die Frucht des Sumachgewächses Rhus oder die schwarze Maulbeere. Manchmal gibt auch die Schale eine gute Farbe ab, wie bei der Zwiebel, der Walnuss und dem Granatapfel. Weitere Pflanzen wie Färberkrapp und Berberitzen liefern mit ihren Wurzeln einen natürlichen Farbstoff.
Die pflanzlichen Färbmittel lassen sich auch danach in zwei große Kategorien einteilen, ob sie Oxalsäure enthalten oder nicht. Diese Säure kann in Blättern, Zweigen, Stamm, Rinde und der Frucht von Pflanzen vorkommen. Oxalsäure wird auch durch besondere Insekten auf Bäumen wie der Eiche zu Kugeln angehäuft. Mit der Oxalsäure lässt sich eine Vielfalt von Farben der Gruppe creme, orangenfarben, braun, grau und schwarz gewinnen. Oxalsäure wird meist für dunklere Farben verwendet. Das gewonnene Farbmittel ist speziell für die Färbung von Knüpfwolle bestimmt und wird immer noch in einigen Gegenden Irans vom Färber eingesetzt.
Der Färber zieht bei der Arbeit drei Hauptfarben heran, nämlich Blau, Rot und Gelb. Durch Mischung von jeweils zwei dieser Farben werden weitere Farben gewonnen wie Violett, Orange und Grün. Werden die drei Hauptfarben im entsprechenden Verhältnis vermischt, entstehen Schwarz oder weitere Farben wie Rotbraun und Hellbraun usw.
Beim Färben von Wolle, Baumwolle und Seide mit pflanzlichen Mitteln werden auch mineralische Stoffe hinzugezogen wie Alaune, Eisen- und Aluminiumsalze, Oxal- oder Zitrussäure, Indigopulver oder Natriumhydroxid und Natriumhydrogensulfid, je nach Wunsch mit unterschiedlichen Anteilen.
Diese Beigaben dienen der Festigung der Farben und Stärkung des Farbschimmers.
Auch die Benutzung von tierischen Stoffen bei der Färbung des Knüpfmaterials ist interessant. Den wichtigsten tierischen Färbstoff liefert die bereits oben genannte Cochenillenschildlaus. Sie stammt ursprünglich aus Mexiko und wurde von dort aus nach Europa auf die Kanarieninseln gebracht. Diese Schildläuse leben vor allen Dingen auf Kakteen. Die oben erwähnten Stachelschnecken, die ein ausgezeichnetes Purpurrot liefern, leben zumeist an den Mittelmeerküsten.
Der Färbvorgang verläuft traditionell in großen kupfernen Kesseln, die aufgeheizt werden. Die Wolle wird nach oder vor dem Spinnen gefärbt. Nach dem Färben wird sie in einer kleinen Schleuder weitgehend getrocknet. In größeren Färbereien verlaufen die Vorgänge alle mechanisiert und es werden statt Kupfelkessel große Dampfkessel verwendet. Dort wird die Wolle im gesponnenen Zustand gefärbt. Die Fäden der gewaschenen und entfetteten Wolle werden wie ein Schal um gelöcherte Spulen gewickelt. Die Löcher dienen dazu, dass die Farbe die Fäden richtig durchtränkt. Die Spulen werden nur so stark umwickelt, dass sie einander nicht berühren. Das Entfetten der Wolle ist nötig, weil sonst die Farbe nicht richtig in das Material eindringt und nicht gleichmäßig wird. Für das Waschen wird industrielle Seife verwendet.
Die Temperatur für das Färben von Wolle liegt bei 45 bis 50 Grad.
Die Benutzung von chemischen Farbmitteln für die Färbung der Knüpfwolle wird von den Teppichexperten nicht begrüßt. Bei solchen synthetischen Farben handelt es sich unter anderem um Metallic-Farben, Reaktiv- und Direktfarben sowie Schwefelfarbstoffe.
Wie wir schon sagten, spielt die Anwendung von Farben für den iranischen Teppich eine wichtige Rolle und daher ist auch die Färbkunst des Knüpfmaterials von großer Wichtigkeit. Früher benutzte man nur natürliche Farbmittel, doch dann wurden auch chemische üblich. Allerdings stellte man bald fest, dass sie mit der Zeit durch Waschen und Lichteinwirkung verblassen und in Wahrheit die pflanzlichen Färbmittel viel besser sind. Zwar ist die Gewinnung von pflanzlichen Farben schwieriger, aber die Verwendung von solchen natürlichen Färbmitteln ist für den Erhalt des Qualitätsniveau und Markenzeichen des iranischen Teppichs von großer Bedeutung. Dazu kommt ohnehin, dass die hemmungslose Verwendung von chemischen Stoffen und Farben auch die Umwelt gefährdet. Dies ist also ein weiterer Grund dafür, dass die Anfertigung des iranischen Teppichs von den chemischen Farbmitteln frei bleiben sollte.