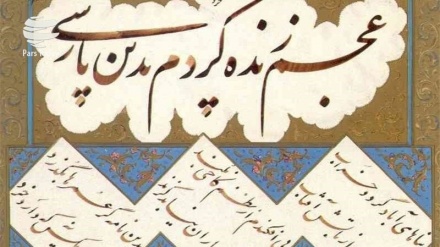Iranisches Kunsthandwerk (42 - handgemachte Stoffe)
Ab diesem Teil werden wir eine weitere wichtige Art des iranischen Kunsthandwerkes vorstellen und zwar das Weben von Stoffen. Die iranische Kunst des Webens blickt auf eine lange Vergangenheit zurück. Früher fanden manuell angefertigte Stoffe natürlich überall im alltäglichen Leben Verwendung, während sie heute vor allen Dingen dekorativen Wert haben.
Die im Iran üblichen handgewebten Stoffe aus Baumwolle, Wolle oder Seide heißen unterschiedlich, zum Beispiel Zari, Machmal, Termeh, Darai, oder Dschadschim , um einige Bezeichnungen zu nennen.
In Nordiran hat man in der prähistorischen Kamarband-Höhle, in der Nähe von Behschahr, Werkzeuge aus dem 6. bis 7. Jahrtausend vor Christus gefunden, die darauf hindeuten, dass die Höhlenbewohner Wollfäden gesponnen haben. Ab circa 4200 vor Christus haben die Bewohner der iranischen Hochebene, nachdem sie vorher Bekleidung aus Tierhäuten und Fellen trugen, Wollstoffe für ihre Bekleidung angefertigt. Dies ist an den Figuren und Zeichnungen aus dieser Zeit abzulesen.
Herodot- der griechische Historiker - hat das Stoffweben im Iran in der Zeit vor Christus geschrieben. Die ersten Spuren für Webstoffe in unserem Land werden in das 5. Jahrtausend vor Christus datiert und man hat sie in Schusch (Susa) im Süden Irans gefunden. Außerdem fand man in den historischen Hügeln Tepe Hisar in Damghan in der Provinz Semnan, östlich von Teheran, Spinnwerkzeuge aus der Zeit 3000 vor Christus, welche für auf eine Weiterentwicklung der Spinntechnik zu dieser Zeit sprechen.
Wie sich in den Felsreliefen aus der Epoche der Meder widerspiegelt, wurden zu der Zeit ausgezeichnete Stoffe aus Schafswolle und Ziegenhaar gewebt und Wollstoffe wurden mit Gold- und Silberfäden durchwirkt. Gemäß den Aufzeichnungen der Historiker und Forscher war die Farbe Arghawani (Purpur) sehr beliebt bei den Medern, dies insbesondere bei Stoffen. Schon in der Zeit der ihnen nachfolgenden Achämeniden ( 6. bis 4. Jahrhundert vor Christus) wurden im Iran schöne weiche Wollstoffe angefertigt. Am Königshof waren Brokatstoffe beliebt. Aus dem Partherreich der Arsakiden, die vom ersten Jahrhundert vor Christus bis ins zweite Jahrhundert nach Christus über Iran herrschten, sind nur wenige Stoffe verblieben, aber unter ihren Nachfolgern , den Sassaniden, blühte die Webkunst wieder auf und erreichte einen Höhepunkt. Die Sassaniden verwendeten in ihren Palästen viele kostbare Gewebe zur Dekoration.
Der bekannte Weltenreisende Yuangzang hat die asiatischen Länder im 7. Jahrhundert nach Christus beschrieben und dabei auch die Erzeugnisse der Manufakturen im Iran erwähnt, darunter Seide- und Wollstoffe.
Arthur Christensen, ein dänischer Forscher bestätigt, dass das Weben von Stoffen ein wichtiges und angesehenes Handwerk der Iraner war. Gemäß historischen Schriften wurde die Flagge des Römischen Reiches aus iranischem Stoff angefertigt und konnte die iranische Seide mit der aus China konkurrieren.
Auf den erhalten gebliebenen Seidenstoffen aus der Zeit der Sassaniden sind Tiere, Vögel und Reiter auf der Jagd oder geometrische Figuren abgebildet.
Als die Islamische Ära im 7. Jahrhundert einsetzte und besonders zu ihrem Beginn, war die Webkunst noch von der Zeit der Sassaniden geprägt. Die Technik änderte sich nicht, wohl aber die Muster und Motive auf den Stoffen wurden anders. Eine weitere Phase der Entfaltung erfuhr dieses Handwerk im Zeitraum 2. bis 4. Jahrhundert nach der Hidschra, d. h. vom 8. bis 10. Jahrhundert nach Christus. Die Webkunst erlebte erneut einen Aufschwung. Davon zeugen die gelungenen Exemplare, die im Kairoer Museum für Islamisches Handwerk aufbewahrt werden. Sie stammen aus Merw, der Hauptstadt des Abbasidenkalifen al Ma‘ mun von 813 bis 833 nach Christus, sowie aus dem alten Neyschabur im Nordosten Irans.
Die Umayyaden und Abbasiden führten erneut Brokat- und Seidenstoffe an ihren Herrscherhöfen ein. Allerdings trugen diese neuen Muster. Typisch für die Stoffe aus diesem Abschnitt der islamischen Ära ist die Verwendung von Seidenfäden als Randverzierung.
Einige Sachverständige betrachten die Epoche der Seldschuken, welche im 11. und 12.Jahrhundert nach Christus herrschten, als Epoche der Vollendung der iranischen Webkunst. Es entstanden ganz neue Stoffmuster. Allerdings setzte in dieser Zeit auch der Einfluss des chinesischen Stils ein und es wurden detailliertere Abbildungen von Tieren und Pflanzen auf Seidenstoffen üblich. Es gibt einige Seidenstoffe mit weißen und grünen Tier- und Pflanzenbildern im kufischem Stil auf goldenen, dunkelroten und braunen Untergrund aus der Seldschukenzeit.
Die Stadt Rey beim heutigen Teheran war unter dieser Herrscherdynastie das wichtigste Zentrum der Webkunst. Die Stoffe aus dieser Stadt waren für ihre ideenreichen Muster und schönen Farbkombinationen und ihre Qualität bekannt. Aber auch die Städte Täbris im Westiran und Kaschan und Yazd im Zentrum des Landes waren in dieser Epoche für ihre Webstoffe berühmt.
Als die Mongolen einfielen und die Macht über Iran an sich rissen, nahm der Einfluss des chinesischen Stils auf die Anfertigung von Stoffen zu, denn die Einfuhr von chinesischen Waren und der Handel zwischen Iran und China war gewachsen und es kamen außerdem zahlreiche chinesischen Weber ins Land. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach chinesischer Ware, ahmten auch die iranischen Webkünstler den chinesischen Stil nach. Wir erkennen den Einfluss aus China an der Verwendung von chinesischen Motiven auf iranischen Stoffen wie Drachen und Fabeltiere, Wasserlilien und die typisch chinesischen Wolkenbilder. Zu den bekannten Zentren für die Webkunst dieser Zeit gehören die Städte Herat (heute Afghanistan), Neyschabur und Merw im Nordosten Iran und Täbris im Westen des Landes.
Unter den Timuriden (14. Bis 16. Jahrhunderts) führten die Stoffmanufakturen in den zentralgelegenen Städten Yazd, Isfahan und Kaschan, sowie in Täbris ihre Gewebe in alle Teile des Islamischen Reiches aus und dieses Handwerk erfuhr eine enorme Weiterentwicklung. Aber die eigentliche goldene Epoche trat erst unter den Saffawiden ein, welche von 1501 bis 1722 herrschten.
Die Stoffe aus der Saffawiden Zeit sind einmalig in der Weltgeschichte der Webkunst. Sie erfreuten sich einer großen Mustervielfalt. Diese Stoffe aus Brokat, Samt, Seide und Baumwolle in den schönsten Farben wurden auf europäischen Märkten und in Russland gehandelt. Viele dieser kostbaren Gewebe zeigten Szenen aus dem berühmten Schah-Nameh von Ferdowsi und aus anderen literarischen Werken oder Bilder von schönen Gärten und der Jagd.
Besonders verbreitet war unter den Saffawiden eine Seidenart namens „Taafteh“. Dieser Stoff wurde in Isfahan und in dem Dorf Abyaneh, beides Orte in der Provinz Isfahan, gewebt. In der zentraliranischen Stadt Yazd fertigte man mehrlagige Stoffe an. Die eine Stoffseite war glatt und gleichmäßig, die Webstruktur meist diagonal. Die außergewöhnlichen Samtstoffe aus der saffawidischen Zeit sind sehr feingemustert und ihre Farbkombination ist vollendet. In die Seide oder den Samt wurden manchmal auch Silberfäden eingewebt. Die kostbaren Termeh-Stoffe mit ihren islimischen Mustern (Arabeske-Dekor) wurden in Yazd und im ostiranischen Kerman angefertigt.
Als Motive zur Musterung der Stoffe der Saffawidenzeit dienten Festszenen, Tierfiguren, Zypressen und Ulmen und Prinzen auf der Jagd. Die bekannten Isfahaner Qalam-Kaar-Stoffe, welche mit Stempeln bedruckt werden, waren hoch in Kurs. Isfahan wurde als Zentrum für diesen Stoffdruck weltbekannt.
Nach den Saffawiden ließ einige Jahrzehnte lang die Bedeutung der Stoffherstellung nach und ging die Zahl der Webereien zurück. Kostbare Stoffe wurden hauptsächlich nur noch in einigen dörflichen Gegenden und bei den Nomaden gewebt.
Die heutigen Zentren für handgewebte Stoffe sind die Provinzen Yazd, Zentraliran, Chorrassan in Nordostiran, Chusistan im Süden und die nordiranischen Provinzen Mazanderan, Gilan und Golestan. In Teheran und in Kaschan und in den Isfahaner Berufsschulen für Schöne Künste werden noch Samt und Brokat gewoben und die Kunst des Termehwebens blieb in Kerman und Yazd bestehen. Isfahan behielt das Monopol für die Musterung von Stoffen mit Stoffstempeln (Qalamkaar).