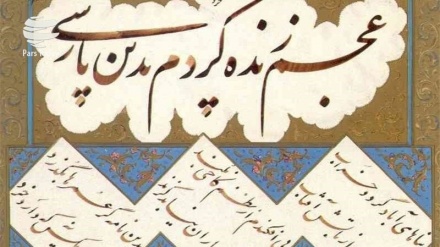Iranisches Kunsthandwerk (50)
Wir haben beim letzten Mal mit einem Einblick in die Geschichte der iranischen Bekleidung begonnen, sozusagen als Einleitung zur Beschreibung der manuellen Anfertigung von Bekleidung. Kleidung ist ein wichtiges kulturelles Symbol und eines der wichtigsten äußeren Merkmale von Völkern, welches sich aber auch rasch durch Übernahme der Kultur anderer Gesellschaften ändern kann.
Einige sagen sogar, dass die kulturelle Vorherrschaft bei der Übertragung von Kleidungssitten beginnt und sich durch Änderung der Bekleidung in einer Gesellschaft auch eine Änderung der sozialen Lebensstrukturen einer Gesellschaft aufdrängen lassen. Es gibt dafür zwei anschauliche Beispiele zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nämlich die veränderte Bekleidung, die Reza Chan, der Vater des Schahs der iranischen Bevölkerung aufzwang, und die neuen Kleidungsvorschriften, die Kemal Atatürk in der Türkei anordnete.
Die Bedeckung des Körpers war schon in der iranischen Antike wichtig und wurde erst recht vom Islam betont. Die iranische Bekleidung hat seit der Entstehung des Landes keine großen Veränderungen erfahren. Bekleidung wird im Persischen auch „Puschesch“ genannt, was „Bedeckung“ bedeutet.
Aus der Bekleidung eines Volkes oder einer Zivilisation ergeben sich Informationen über den geschichtlichen Entwicklungsverlauf, die Ästhetik, die Überzeugungen und die Gesellschaftsschichten und natürlich über die Kunst der Stoffherstellung.
Folgende Faktoren bestimmen generell über die Form der Bekleidung: geografische und klimatische Bedingungen, Lebensweise und soziale Lage, Kriege und politischen Zustände sowie Art der Regierung, wirtschaftliche Bedingungen und technische Fortschritte. Aber auch andere Dinge spielen mit: wie die religiösen Überzeugungen, Brauchtum und Sitten, das herrschende Klassensystem und die kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu den benachbarten Gebieten.
Es ist nicht zu vergessen, dass die Bekleidung aller Iraner gemeinsame Merkmale aufweist, die sie von der Bekleidung anderer Völker unterscheidet. Zum Beispiel ist unter den Frauen aller iranischer Volksgruppen eine Kopfbedeckung üblich: Die Turkmeninnen im Norden tragen ein großes geblümtes Kopftuch (Maqnae) und die Frauen der Zaroaster ein Kopftuch aus Spitze. Besonderer Art ist auch das Kopftuch unter den Frauen von Gilan und wieder anders das Kopftuch in mehreren Farben der Kurdinnen.
Kleidung soll vor Kälte und starker Sonnenbestrahlung schützen oder zur Verhüllung des Körpers dienen. In einigen Kulturen sind die Farben und Muster auf dem Stoff und die Verzierung von Kleidung ein Wahrzeichen für eine bestimmte Ethnie oder für einen besonderen gesellschaftlichen Rang. Die verschiedenen iranischen Völker haben wegen ihrer besonderen Kultur und Sitten jedes ihre eigenen Trachten. Die Frauen auf dem Dorf und die Nomadenfrauen in den verschiedenen Klimazonen bevorzugen fröhliche Farben. Gerne verwenden sie auch zur Verzierung ihrer Kleidung Bänder mit eingewobenen Goldfäden und schmücken den Stoff mit kleinen Münzen und Perlenstickerei.
Die Völker in den verschiedenen Teilen Irans haben ihre bestimmten völkischen Besonderheiten. Die bekanntesten von ihnen sind die Aserbaidschaner, Balutschen, Bachtiaren, Turkmenen, die Chorasani, Qaschqai, Kurden, Gilaner, Loren, Mazanderaner und die Dschonubi (die im Süden wohnen).
Unter den iranischen Volksgruppen ist es schon seit langem Brauch gewesen die Volkstracht zu verzieren und daraus haben sich verschiedene Zweige des Kunsthandwerkes entwickelt. Die üblichen Muster zur Ausschmückung von Kleidung sind stilisierte Blumen, das Boteh-Design, geometrische Figuren Natur- und Menschenbilder und Musterkombinationen.
Die Verzierung von Kleidung mit stilisierten Blumen- und Pflanzenbildern variiert je nach dem Geschmack einer Gegend. Wir finden sie besonders bei den abwechslungsreichen Stickereien der Turkmenen und Balutschen vor und zwar werden meistens die Ärmelenden, die Rockränder und der Kragen bestickt, manchmal auch der ganze Kleidungsstoff.
Eines der wichtigsten iranischen Verzierungsmuster ist das Boteh-Design. Dieses Boteh-Motiv oder genauer gesagt „Boteh Dschoqeh“ kommt eigentlich in vielen Bereichen des Kunsthandwerkes vor. Es ist ein original iranisches Muster für die Verzierung von Stoffen, Teppichen, Gelims, Kacheln, Tongefäßen, Schals, Brokatstoffen usw. Boteh Dschoqeh ist das stilisierte Bild einer Zypresse.
Die Zypresse ist für die Iraner das Wahrzeichen des freiheitlichen Denkers, der bescheiden seinen Kopf senkt. Boteh Dschoqeh ist also die Verkleinerung einer sich neigenden Zypresse. Das Motiv ähnelt einem unten bauchigen Blatt, das nach oben hin schmaler wird und dessen Spitze sich schließlich zur Seite neigt. Das Boteh-Muster kommt als Stickerei auf iranischen Stoffen vor oder es wird eingewoben bzw. aufgedruckt. In einigen Gegenden Irans wird das Boteh-Muster mit geometrischen und abstrakten Mustern kombiniert.
Ein weiteres Muster auf Stoffen und Folklore-Kleidung ist geometrischer Art. Diese so genannten Hendesi-Muster sind einfach und dennoch sehr schön. Sie werden bei der Bevölkerung von Sistan wa Balutschistan im Südosten Irans als Quadrate in Stoffe eingewoben und auf Kleidung aufgestickt. Schon auf der Kleidung aus der iranischen Antike finden wir Verzierungen mit geometrischen Linien vor und in der Islamischen Ära werden erst recht geometrische Muster in den dekorativen Künsten so auch bei der Verzierung von Kleidung verwendet.
Nachbildungen der Natur wie Abbildungen von Tieren, Pflanzen und Menschen gehören ebenfalls zur Musterung von Stoffen. Auf dem ältesten iranischen handgeknüpften Teppich, dem Pasyryk (4.bis 5. Jahrhundert vor Christus) sind Reiter abgebildet. Auf den Stoffen aus der Sassanidenzeit (3. bis 7. Jahrhundert nach Christus) sind auch Bilder von Menschen und Tieren, wie Vögel und Löwen, zu sehen.
Natürlich gibt es auch Kleidermuster, bei denen verschiedene Motive kombiniert wurden. Dazu gehören auch die Muster mit Fabelwesen und Phantasieblumen, geflügelten Löwen, Drachen und dem legendären Vogel Simorgh. Der geflügelte Löwe ist eine der ältesten Verzierungsfiguren auf iranischer Kleidung. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür auf den Kleidungsstoffen der Sassanidenzeit. Zur Zeit der Ilchane im 13. bis 14. Jahrhundert nach Christus wurden in Nachahmung chinesischer Kunst Drachenbilder im Iran Mode.
Zur Verzierung von Kleidung bedient man sich der Nadelstickerei oder des Stoffdruckes oder Stoffstempeln, oder Teke-Duzi – eine Art Patchwork (Flickwerk). Welche Methode bevorzugt wird, ist je nach Gegend verschieden. In vielen Gegenden besonders auf dem Lande benutzt man auch Perlen und Münzen und Plättchen oder Stoffbänder zur Verzierung von Kleidung. Schon aus der Zeit vor den Medern liegen Beispiele für letzte Art von Bekleidungsschmuck vor. Zum Beispiel wurden bei den Medern, die bis zum 6. Jahrhundert vor Christus herrschten) Glöckchen am Rand von Röcken befestigt.
Aus Reiseberichten erfahren wir, dass die Frauen ihre Kleidung mit kleinen Münzen schmückten und diese Verzierung gehört heute noch zu den Trachten von Völkern auf der iranischen Hochebene, wie die Kurden und Loren, die Ascha`ir (Nomaden) von Aserbaidschan, und die Qaschqaschi, oder bei den Einheimischen von Chorasan, Semnan, Gilan und bei den Turkmenen. Nicht nur Münzen sondern auch kleine Plättchen (Pulak) dienen der Verzierung von Bekleidungsstücken. Für die Volkstrachten der Kurden und Turkmenen sind außerdem kleine Perlen aus Metall und Glas und heutzutage auch aus Plastik üblich.
Wichtig ist auch die Verzierung mit Bändern. Früher wurden diese Bänder eigenhändig aus Stoff zurechtgeschnitten und mit Stickgarn oder Perlen verziert. Aber heute benutzt man Bänder, die es fertig zu kaufen gibt. Früher war es als traditioneller Kleiderschmuck üblich, die Ränder von Kopftüchern oder den Kleidungskragen mit kleinen Bommeln zu schmücken. Diese Verzierung mit Bommeln ist vor allen Dingen im Westen sowie im Nordosten im Gebiet Qutschan von Razavi-Chorasan beliebt